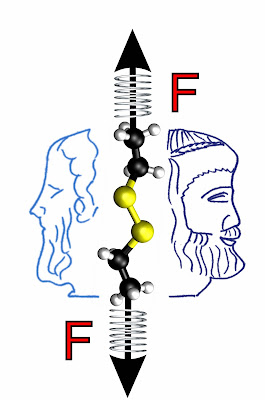Meine persönliche Einführung in die Hochbegabung
Wenn Sie sich die Frage stellen: „Wie finde ich heraus, ob ich hochbegabt bin?“ – dann werden Sie hier Antworten finden. Ich habe die Informationen davon abhängig gemacht, wie gesichert Sie wissen wollen, ob Sie hochbegabt sind. Deshalb meine Frage an Sie: „Wie GESICHERT wollen Sie wissen, ob Sie hochbegabt sind?“
Meine Antworten lassen sich in drei Kategorien einteilen:
❤ Sicherheitsstufe 1: Sicherheit im Hinblick auf das Wissen „Ich bin hochbegabt“ – hier können Sie mal schnuppern, wie Hochbegabte so ticken.
❤ Sicherheitsstufe 2: Sicherheit im Hinblick auf das Wissen „Ich bin hochbegabt“ – hier bekommen Sie Tipps, was Sie tun können, um herauszufinden, ob Sie tendenziell hochbegabt sind.
❤ Sicherheitsstufe 3: Sicherheit im Hinblick auf das Wissen „Ich bin hochbegabt“ – Adressen. Hier können Sie sich zum IQ-Test anmelden. Das Ergebnis des IQ-Test sagt Ihnen, wie hoch Ihr IQ ist. Ist er über 130 Punkte, sind Sie hochbegabt. Über 145 Punkte sind Sie höchstbegabt.
Aber was ist überhaupt Hochbegabung?
Die Antwort ist einfach. Treffend hat sie einmal der Psychologe Dr. Jürgen vom Scheidt so beantwortet: „Es ist das intellektuelle Potenzial von jemandem, der in einem der gängigen und anerkannten Intelligenztest einen IQ-Wert von 130 Punkten und mehr erzielt. Dies betrifft, streng genommen, 2,27 Prozent der Bevölkerung.“ http://www.hyperwriting.de/loader.php?pid=276 Stand: 20.09.2015
Und was ist HÖCHSTBEGABUNG?
Ganz einfach. Dr. Sylvia Zinser schreibt: „Ist der IQ über 145 so spricht man von Höchstbegabung.“ http://zinser.no-ip.info/~szinser/gifted/faqhg.htmlx Stand: 19.09.2015
Allen Hochbegabten und Höchstbegabten empfehle ich das informative, spannende und vergnügliche „Sylvia Zinser's Sammelsurium“ http://zinser.no-ip.info/~szinser/ Stand: 19.09.2015 Hier erfahren Sie nicht nur etwas über den IQ, sondern auch über „Brot, Schwaebische Traeubleskuchen sowie über diverse Weihnachtsplätzchen“ http://zinser.no-ip.info/~szinser/backen.htmlx Stand: 19.09.2015
❤ Sicherheitsstufe 1: Sicherheit im Hinblick auf das Wissen „Ich bin hochbegabt“
Man sagt oft von Hochbegabten: „Die haben eine 1 (Bestnote) in Mathe – können aber ihre Schuhe nicht richtig zubinden“. Soll heissen: das Denken funktioniert (in bestimmten Bereichen) ausgezeichnet – aber im Alltäglichen kommen sie mit bestimmten Situationen nicht gut zurecht. Nach meinen Erfahrungen ist diese Aussage für einige Hochbegabte wirklich sehr zutreffend – für andere weniger bis gar nicht.
Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Bei meinem Mathelehrer hatte ich so gut wie immer eine 1. Allerdings hatte ich auch eine Mathelehrerin. Sie war eher der Typ „Geschichtenerzählerin“. Sie sprach gerne über ihre Lieblingsrezepte, ihre Backkunst und ihren Hund. Ich war so damit beschäftigt, herauszufinden, was das mit Arithmetik zu tun hatte, dass ich ihr, wenn es denn mal was zu rechnen gab, kaum noch folgen konnte.
Meine Noten in Mathe lagen bei ihr im Mittelfeld. Und ich war richtig dankbar als der in meinen Augen „richtige“ Lehrer kam. Der mir Mathe so erklärte, dass ich es verstanden habe. Ich machte Überstunden in Mathe und liess mir extra Hausaufgaben geben. Nein, ich war keine Streberin. Ich hatte einfach Spass an Problemlösungen. Aber wenn ich meine Strickjacke zuknöpfen sollte – da gab es Stress für mich. Jedenfalls dieser Lehrer schickte mich zum Schulpsychologen, der mich positiv auf Hochbegabung testete. Da er sagte: „Du darfst mit niemandem darüber reden, dass Du diesen IQ von … hast.“ – dachte ich: vielleicht ist es eine Krankheit oder sonst wie ansteckend. Ich habe nie darüber gesprochen. Erst vor gut zehn Jahren habe ich mich in meiner Familie geoutet.
Meine Kollegin Alexandra in unserem Markt- und Sozialforschungs-Institut war da ähnlich unterschiedlich in ihrer Mathe-Begabung. Obwohl sie ein echtes Mathe-Genie ist, gab es auch für sie Grauzonen. Normalerweise hörte sie von einer Aufgabe oder schaute auf das Papier. Und schwupp – schon hatte sie die Lösung. Manchmal trat sie einen Wettstreit mit unserem Computer an. Nicht immer war unser PC der Gewinner. Doch dann gab es für sie echte Herausforderungen: Wenn sie ohne Hilfsmittel Prozent rechnen sollte, versagte sie fast jedes Mal. Nicht mal 10 Prozent von 100 konnte sie richtig errechnen. Allein bei dem Wort „Prozentrechnen“ driftete sie immer ab. Im Laufe der Zeit wurde es allerdings besser.
Ich will damit sagen: Nicht alle Hochbegabte sind Mathe-Genies. Nicht alle Mathe-Genies sind fehlerlos. Tröstlich ist, was Albert Einstein einmal über Mathe gesagt hat: „Mach' dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind.“
Mit anderen Worten: Nicht jeder Hochbegabte glänzt in Mathe. Eine Klientin von mir war die Vorgesetzte der ehemaligen Lehrerin eines Fußballnationalspielers (Weltmeister!). Er hatte wenig Interesse an Zahlen und sagte bereits in jungen Jahren zu der Lehrerin: „Warum soll ich Rechnen lernen? Ich werde mal ein berühmter Fußballspieler. Und dann kann ich mir so viele Rechenkünstler leisten wie will.“ Die Lehrerin staunte. Doch der Junge hatte Recht. Er ist hochbegabt UND hochsensitiv.
Hochbegabte können sehr gut oder gut rechnen – oder auch gar nicht. Was sind nun die die typischen Eigenschaften von Hochbegabten?
Gehen wir noch einen Schritt zurück. Genauso wie nicht alle Kölner lustig sind, nicht alle Münchner Lederhosen tragen und nicht alle Hamburger einen Segelschein haben – so sind auch nicht alle überdurchschnittlich intelligenten Menschen so oder so.
Nehmen wir einmal eine Einteilung der Hochbegabten vor, die Jürgen vom Scheidt heraus gearbeitet hat. Er unterteilt fünf (drei plus zwei) Gruppen. Selbstredend gibt es noch andere Kategorien – dazu komme ich noch.
Scheidt zufolge gibt es – vereinfacht ausgedrückt – bei den Hochbegabten, abhängig von dem Kriterium „Erfolg in der Schule, im Beruf“ folgende Trias:
O Ein Drittel, die ihre „Begabung erfolgreich verwirklicht“ haben. Sie sind Topmanager/innen, Spitzensportler/innen, Unternehmer/innen, Künstler/innen, Wissenschaftler/innen usw. Sie wurden z.B. von der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“ oder anderen Institutionen erkannt und gefördert.
O Ein Drittel sind sogenannte „Latente“: Sie spüren, ahnen oder wissen um ihre Begabung, kommen aber nicht so einfach aus dem Quark. Die Psychologin und Expertin für Hochbegabung, Andrea Brackmann, schreibt in ihrem zweiten Buch, dass „Hochbegabung Mut erfordere“ http://www.klett-cotta.de/buch/Klett-Cotta_Leben!/Ganz_normal_hochbegabt/13265 Stand: 19.09.2015. Bei dieser Gruppe verstehen wir, warum das so ist.
O Ein Drittel sind nach Scheidt die „Underachiever“ („Minderleister“). Sie könnten schon – wollen aber (noch?) nicht erfolgreich sein. Speziell zu Minderleister/innen in der Schule noch einmal Sylvia Zinser: Ihr Geheimtipp J: MOTIVIEREN! http://zinser.no-ip.info/~szinser/gifted/faqhg.htmlx Stand: 19.09.2015
So, das sind unsere drei Gruppen – zwei kleine Gruppen fehlen noch:
O Es sind die „Entgleisten“: sie sind erfolgreich – aber auf kriminelle oder soziopathische Weise.
O Dies sind die Höchstbegabten wie etwa Einstein und Freud.
Alle Infos zu dieser Einteilung in der Veröffentlichung von Jürgen vom Scheidt: http://www.hyperwriting.de/loader.php?pid=276 Stand: 19.09.2015
Wer bis hierher tapfer durchgehalten hat – wird jetzt belohnt. Jeder Mensch, der denkt: Analyse? Mathe? Logik? Das sind jetzt nicht so meine Stärken. Ich bin eher der Musiker, die Malerin, der Tänzer, die Fotografin, der Praktiker. Gut so. Es gibt insgesamt sieben Felder der Hochbegabung: mein Bruder Helmut glänzt z.B. durch „Praktische Intelligenz“: Er erkennt sofort im realen Leben wie man es richtig zumindest aber besser machen kann. Mir bleibt diese Art zu denken verborgen. Zumindest müsste ich viele Bücher lesen, um diese Dinge verstehen zu können. Mir fällt es schon schwer genug, meine Jacke richtig zuzuknöpfen.
Prof. Werner Stangl zitiert Prof. Kurt Heller auf seinen Seiten zu den Themen „Intelligenz und Hochbegabung“ wie folgt:
„Nach Heller (2000) gibt es folgende Begabungsfaktoren:
O Intellektuelle Fähigkeiten (sprachliche, mathematische, technisch-konstruktive, abstrakte, begrifflich-logische, etc. Fähigkeiten)
O Sozial-emotionale Fähigkeiten
O Musisch-künstlerische Fähigkeiten
O Musikalische Fähigkeiten
O Kreativität (sprachliche, mathematische, technische, gestalterische, etc. Kreativität)
O Psychomotorische Fähigkeiten (Sport, Tanz, etc.)
O Praktische Intelligenz“
http://www.stangl-taller.at/TESTEXPERIMENT/testintelligenzhochbegabt.html Stand: 19.09.2015
Wir sehen: Hochbegabung ist spannend. Und es wird noch spannender.
Nehmen wir noch eine weitere Differenzierung vor: Hochbegabte sind oft auch hochsensibel und/oder hochsensitiv. Ihre Sinne sind stärker ausgeprägt. Zum einen (hochsensibel) sind ihre normalen Sinne (hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen) intensiver (Künstler/innen, Star-Köch/innen, Parfümeur/innen – einige haben auch ein begnadetes „Fingerspitzengefühl“ wie etwa Handerker/innen und Chirurg/innen u.a.m.). Und/oder andererseits ist ihre Wahrnehmung (hochsensitiv) tiefer: Diese Hochbegabten haben den sechsten (hellhörig), siebten (hellfühlig) und achten (hellsichtig) Sinn wie etwa Goethe, Einstein und Leonardo da Vinci. Wie sagte Albert Einstein?: „Was wirklich zählt, ist Intuition.“
Bei einer solchen Differenzierung: Wo gibt es da noch Gemeinsamkeiten?
Ich fange mal mit den Tendenzen an: Diejenigen, die in der ‚Flüchtlingszeit im Sommer 2015‘ kreativ, beherzt und schnell helfen – können hochbegabt sein. Denn diese Merkmale findet man oft unter den hohen IQ’lern. Der eine organisiert geschickt, die andere übersetzt, der nächste weiss, wer wo wie helfen kann. Schnelligkeit ist für Hochbegabte so natürlich wie das Atmen. Klar, dass nicht jede/r in allen Bereichen gleich schnell ist. Wenn Sie wüssten, wie lange ich brauche, um meine Jacke zuzuknöpfen …
Doch weiter: Gerechtigkeit für jedermann ist stark vorhanden bei den Begabten ebenso so wie vernetztes Denken und Handeln. Nach Andrea Brackmann gehört das „Mehr von allem“ oft zum Repertoire. Wie etwa das „Erfassen kompletter Zusammenhänge“, „Auffinden vielfältiger Lösungswege“ sowie „hohes Einfühlungsvermögen“. Wie gut, dass Hochbegabte oft nur wenig Schlaf brauchen (4 bis 6 Stunden).
Selbstredend gibt es nicht nur diese sonnigen Seiten der hochtalentierten Menschen. Ihre Schattenseiten sind nicht nur für die Beteiligten selbst unangenehm: Oftmals übersteigerte Konzentration bei den SPEZIALISTEN auf ein Spezialthema (Musik oder Sport oder Politik oder Finanzen oder Sprachen oder oder oder). Bei den Generalisten ist es etwas anders: Hier überwiegt die Vielseitigkeit, die sich in mehreren Berufen und Hobbies zeigt. Bei beiden wird die Familie, werden Freund/innen und Kolleg/innen schon mal etwas vernachlässigt. Denn Hochbegabte sind oft Perfektionist/innen. Und es kann mal etwas länger dauern bis sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind.
Routine ist ihnen oft ein Gräuel. Manche finden kreativ alternative Wege um dieser Routine immer wieder auszuweichen. Andere plagen Zweifel und Gewissensbisse. Geduld ist ebenfalls keine Stärke der Hochbegabten. Auch nicht begabt sind diese Menschen, wenn es um „einfache Aufgaben“ geht. Die Hochtalentierten sind zumeist empfindlich. Empfindlich gegenüber Lärm, Licht und manche auch gegenüber Berührungen.
So ist es zu verstehen, dass Hochbegabte an bestimmten „Allergien“ leiden, die Andrea Brackmann in ihrem Buch so schlüssig schreibt. Es sind die „hässlichen Worte“ für Hochbegabte wie etwa „Betriebsausflug“, „Stammtisch“, „Schützenfest“, „Höflichkeitsfloskeln“, „Grossraumbüro“. http://www.klett-cotta.de/buch/Klett-Cotta_Leben!/Ganz_normal_hochbegabt/13265 Stand: 19.09.2015
Hingegen lieben Hochbegabte oft „Querdenker/innen“, „Nobelpreisträger/innen“, „Verarbeitungsgeschwindigkeit“, „Freiheit“, „Endlos-Fragen“, „Monologe“ sowie „Spezielle Themen wie etwa die frühkindliche Entwicklungsphase des Kaiserschnurrbarttamarins, die Pflege der Araukarie oder den „Compte rendu au Roi“ des Finanzminister Jacques Neckers in der Zeit der Französischen Revolution.
Für Hochbegabte ist das alles „normal“ – während das „Normale“ schon sehr schwierig sein kann. Viele habe da ein Selbstverständnis wie Albert Einstein: "Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig."
Wenn Sie das alles gelesen haben, sind Sie an Hochbegabung interessiert. Die anderen haben eh längst das Weite gesucht. Vielleicht wollen Sie genauer wissen, ob Sie hb sind – „hb“ ist das Kürzel bei den „HB“ (Hochbegabten) für „hochbegabt“. Und deshalb gehen wir jetzt auf die nächste Stufe über.
❤ Sicherheitsstufe 2: Sicherheit im Hinblick auf das Wissen „Ich bin hochbegabt“
Ich habe hier IQ-Informationen zusammen gestellt, die Ihnen eine Tendenz Ihrer Begabung aufzeigen können.
O Den ersten IQ-Test habe ich 2005 in der Veröffentlichung von Jürgen vom Scheidt gefunden http://www.hyperwriting.de/loader.php?pid=276 Stand: 19.09.2015. Obwohl ich mit einiger Skepsis an diese Fragen heranging – mein Test beim Schulpsychologen hat damals mehr als eine Stunde gedauert, wie soll man in wenigen Minuten ein ähnliches Ergebnis erzielen können? – war die Antwort jedoch fast exakt dieselbe, die ich Jahre zuvor vom Psychologen in meiner Schule erhalten habe. Chapeau! Für den Autor.
O Auch wenn mir die Headline sehr plakativ erscheint – diese Information verdient ebenfalls Ihr Interesse: „IQ-Test: Gehören Sie zur Grips-Elite?“ http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/iq-test-gehoeren-sie-zur-grips-elite-a-505427.html Stand: 19.09.2015
O Ein weiterer Test, der Ihnen tendenziell Informationen über Ihre Begabung geben wird, ist von der „Süddeutsche Zeitung“: „Der kostenlose IQ-Test online mit Sofortergebnis http://iqtest.sueddeutsche.de/ Stand: 19.09.2015
O “MENSA” ist das grösste Netzwerk für Hochbegabte. Der Mensa Online-Test ist jedoch eher ein „Spiel“ als ein zuverlässiges Instrument der Begabungsanalyse. Wenn Sie Lust haben: Spielen Sie mal. Mensa weist ausdrücklich darauf hin: „Sie sollten die Ergebnisse dementsprechend nicht allzu ernst nehmen.“ https://www.mensa.de/online-iq-test-raetsel/mensa-online-test/ Stand: 20.09.2015
O Und hier ist die englische Variante von Mensa International: „Mensa Workout“ https://www.mensa.org/workout/quiz/1 Stand: 20.09.2015
❤ Sicherheitsstufe 3: Sicherheit im Hinblick auf das Wissen „Ich bin hochbegabt“
Wenn Sie jetzt bereit sind und der Stunde der Wahrheit – dem wirklich und wahrhaftigen IQ-Test – ins Auge blicken wollen… Dann melden Sie sich an – zum anerkannten IQ-Test.
Meine Empfehlungen:
O Mensa. Der Test dauert 90 Minuten, kostet 49 Euro und wird in 80 Städten in Deutschland durchgeführt. Getestet werden Menschen ab 14 Jahre. https://www.mensa.de/intelligenztest Stand: 20.09.2015
O Bei einer Psychologin – einem Psychologen – aus dem Expertenkreis Hochbegabung/Potentiale der Sektion "Freiberufliche Psychologen" im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) e.V. den IQ-Test machen http://www.die-hochbegabung.de/german/index.html Stand: 20.09.2015
O Sie fragen im Familienkreis, bei Freund/innen oder in der Schule/Universität nach einer Empfehlung für den IQ-Test.
Ich drücke schon mal die Daumen!
Für das Campus-Radio Bonn interviewte ich einmal die höchstbegabte „First“ Lady – Gründungsmitglied – von Mensa Deutschland, Dr. Ida Fleiß. Dabei lernte ich eine kluge, warmherzige und höchst kreative Dame kennen, der es „zu simpel“ war, ihren „Doktor“ in Europa zu machen. Kurz entschlossen reiste sie nach Asien, lernte die Sprache und schaffte auf Anhieb ihre Promotion. Sie konnte schon immer weit und um die Ecke denken.
Als ich sie jedoch fragte: Haben wir schon für jede Intelligenz ein angemessenes Messverfahren – will sagen: Können wir schon jede Begabung testen – sagte sie traurig: Nein. Daran müssen wir noch arbeiten.
Ich möchte diese Erkenntnis all denen mit auf den Weg geben, die sich zwar für hochbegabt halten, aber in einem der IQ-Tests nicht die Schallgrenze von 130 durchbrechen konnten.
Allen Menschen, die Spass an Mathe haben – ja, die speziell eine Vorliebe für das Kopfrechnen hegen, empfehle ich die Seite eines Freundes von Ida Fleiss: Dr. Dr. Gert Mittring http://www.gertmittring.de Gert Mittring ist der amtierende Weltmeister im Kopfrechnen.
© Lilli Cremer-Altgeld, 2015




.jpg)
.jpg)
.jpg)