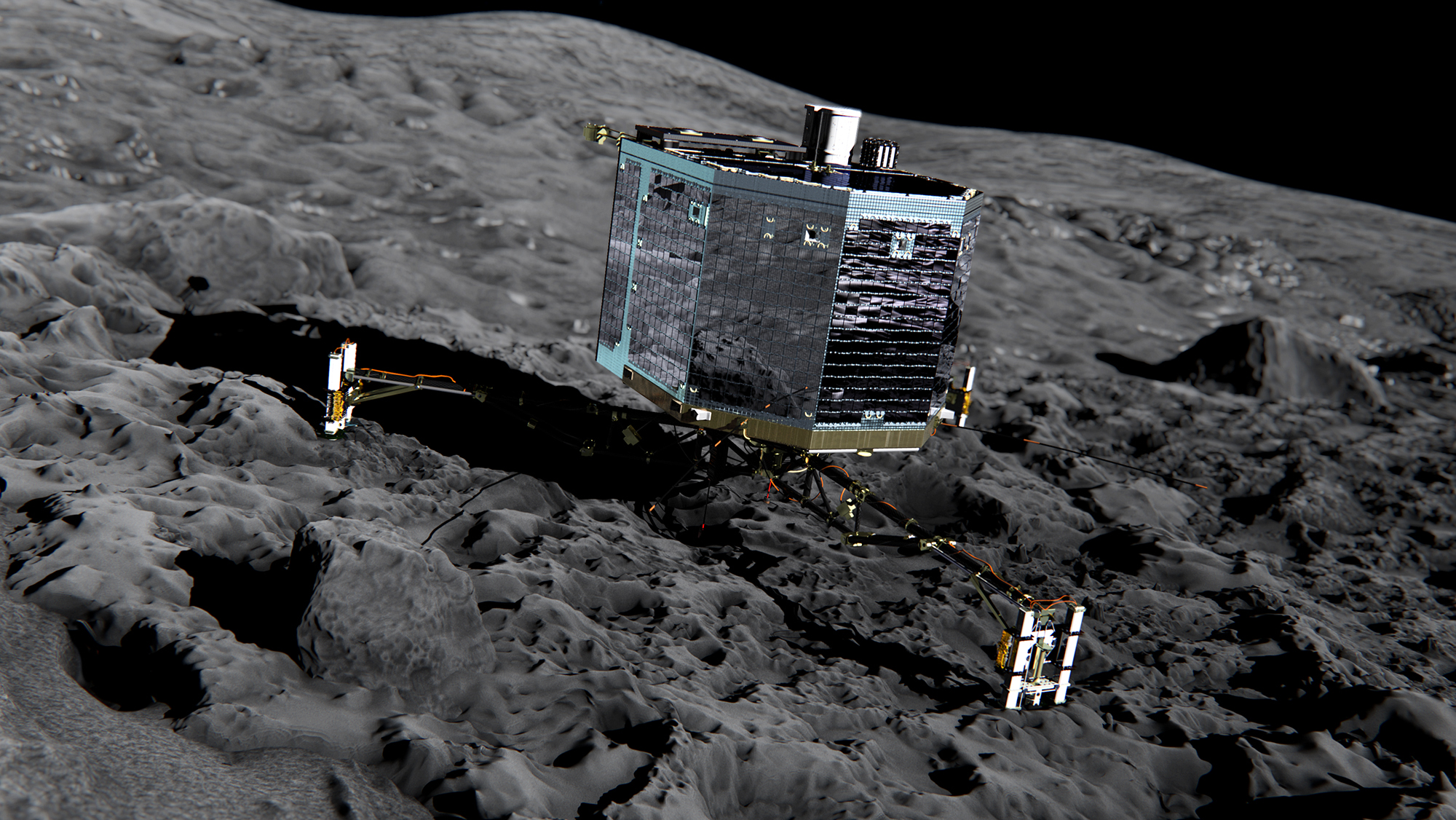 |
Lander Philae
auf Komet Churuymov-Gerasimenko
Quelle
ESA/ATG
|
Die zuletzt andauernde Funkstille hatte es bereits
angedeutet: Ein Kontakt mit Lander Philae wird immer unwahrscheinlicher, und
die Bedingungen für den Lander auf dem Kometen schlechter. "Die Chancen,
dass Philae noch einmal Kontakt zu unserem Team im Lander-Kontrollzentrum des
DLR aufnimmt, gehen leider gegen Null, und wir senden auch keine Kommandos mehr
- es wäre sehr überraschend, wenn wir jetzt noch ein Signal empfangen
würden", sagt Philae-Projektleiter Dr. Stephan Ulamec vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Für Philae bedeutet das, dass er zwar
sehr wahrscheinlich eisfrei, aber voraussichtlich mit Staub bedeckt an seinem
schattigen Platz auf Komet Churuymov-Gerasimenko in den ewigen Winterschlaf
übergeht und sich in der Kälte nicht mehr einschaltet. Die Sonde Rosetta der
europäischen Weltraumorganisation ESA wird hingegen noch bis September 2016 um
den Kometen kreisen und weiterhin mit ihren wissenschaftlichen Instrumenten
Messungen durchführen. Auch die Kommunikationseinheit auf Rosetta wird noch
nicht abgeschaltet - sie wird in den nächsten Monaten solange weiterhin auf
Signale des Landers horchen, bis die dafür notwendige Energie nicht mehr zur
Verfügung steht.
"Es war eine einzigartige Mission mit Philae - es
war nicht nur das erste Mal, dass man jemals mit einem Lander auf einer
Kometenoberfläche aufgesetzt hat, wir haben auch faszinierende Daten erhalten,
mit denen wir noch viele Jahre arbeiten können", sagt Prof. Pascale
Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR und beteiligte Wissenschaftlerin an
der Mission. "Rosetta und Philae haben gezeigt, auf welch faszinierende
Art und Weise die Raumfahrt den menschlichen Horizont erweitern und die
Öffentlichkeit Anteil an unserer Forschung nehmen kann."
Ein Lander mit internationalem Ruhm
Am 12. November 2014 hatte Philae seine spektakuläre
Landung vollbracht. Inklusive eines Harpunensystems, das nach der zehnjährigen
Reise durch das Weltall nicht mehr funktionierte, mehrerer Hüpfer über den
Kometen und eines Standorts, mit dem niemand im Team gerechnet hatte. Weltweit
verfolgten die Menschen, ob die zuvor noch nie versuchte Landung auf einem Kometen
glücken würde. Schließlich konnten die Ingenieure und Wissenschaftler des DLR
um 18.31 Uhr mitteleuropäischer Zeit verkünden: Philae steht auf dem Kometen
Churyumov-Gerasimenko, 510 Millionen Kilometer von der Erde entfernt - und
kommuniziert mit der Erde. Suchmaschine Google widmete sein Startbild dem
Lander und ließ Philae in ihrem Schriftzug anstelle des zweiten O seine drei
filigranen Beine ausstrecken. Zeitungen von Afrika bis Südamerika, von den USA
bis nach Asien und Australien vermeldeten die Nachricht der ersten
Kometenlandung, in allen Sprachen bestätigten Sprecher in den
Nachrichtensendungen, dass Philae tatsächlich sein Ziel erreicht hätte.
Währenddessen arbeitete das Team im Kontrollraum des DLR in Köln rund um die
Uhr, um die sorgfältig vorbereiteten Pläne an die neue Situation anzupassen und
an dem ungeplanten Standort mit Philae zu arbeiten. "Ich hatte schon mit
Interesse gerechnet", sagt DLR-Projektleiter Dr. Stephan Ulamec.
"Aber diese weltweite, riesige und auch andauernde Begeisterung hat mich
sehr positiv überrascht."
Winterschlaf bei Tiefsttemperaturen
Mehr als 60
Stunden forschten die Wissenschaftler mit Philaes Instrumenten, nahmen Fotos
auf, schnüffelten nach Molekülen oder versuchten, sich in den unerwartet harten
Untergrund zu hämmern. Mit seinen aufgeladenen Batterien konnte der Lander auch
an seinem nur wenig von der Sonne beschienenen Standort arbeiten. Alle
gemessenen Daten konnte Philaey sicher zur Erde senden. Nach dem Erreichen des
sonnennächsten Punkt am 13. August 2015 verabschieden sich Komet, Rosetta und
Philae nun wieder aus dem Inneren des Planetensystems:
"Churyumov-Gerasimenko ist inzwischen wieder über 350 Millionen Kilometer
von der Sonne entfernt", erläutert Dr. Ekkehard Kührt, Planetenforscher am
DLR und zuständig für den wissenschaftlichen Anteil des DLR an der Mission mit
Rosetta und Philae. "In der Kometennacht kann es jetzt bis unter minus 180
Grad Celsius kalt werden. Selbst am Tag bleibt der gesamte Komet nun
tiefgefroren." Für einen Lander, der auf Temperaturen bis minus 50 Grad
Celsius ausgelegt ist, ist dies eine Umgebung, in der er nicht mehr arbeiten
kann. Wäre er an seinem ursprünglichen Landeplatz zur Ruhe gekommen und hätte
sich dort im Boden verankert, hätte er deutlich mehr Sonne zur Energieversorgung
zur Verfügung gehabt, wäre aber voraussichtlich im März 2015 bei der Annäherung
an die Sonne überhitzt.
Kontaktschwierigkeiten mit Funkpausen
"Dass Philae sich jetzt sehr wahrscheinlich nicht
mehr melden wird, liegt auch daran, dass seine Energie nicht mehr ausreicht und
die Elektronik zu kalt ist", sagt Philae-Projektleiter Dr. Stephan Ulamec.
Auch in den letzten Monaten gab es keine Funksignale von Philae. Sein Schweigen
im August 2015 hatte jedoch einen anderen Grund: Während des sonnennächsten Punktes
befand sich die Rosetta-Sonde in einer zu großen Entfernung, um Signale des
Landers empfangen zu können und zur Erde weiterzuleiten. "Es gab im
vergangenen Jahr aber auch Zeiten, in den wir nicht verstanden haben, warum
Philae keinen Kontakt zu uns aufnimmt." Philae meldete sich zwar am 13.
Juni 2015 und sendete Daten über seinen Gesundheitszustand. Insgesamt nahm er
auch sieben weitere Male Kontakt zum Bodenteam auf - doch blieb dies
unregelmäßig und relativ unvorhersagbar. Am 9. Juli 2015 sendete er zum letzten
Mal Informationen. "Wir haben immer wieder verschiedene Kommandos
gesendet, um den Kontakt mit ihm zu stabilisieren und mit den Instrumenten
messen zu können, aber dies ist leider nicht gelungen." Die Ingenieure des
Projekts halten es für möglich, dass Kurzschlusse an den Sendern der Grund für
die unregelmäßigen Kontakte und das anschließende Schweigen sein könnte.
Positive Bilanz für eine Premiere
Ingenieure und Wissenschaftler ziehen eine größtenteils
positive Bilanz für die Mission mit dem Lander. "Einige Messungen konnten
zwar leider nicht wie geplant durchgeführt werden, aber insgesamt war Philae
ein Erfolg", betont DLR-Planetenforscher Dr. Ekkehard Kührt. "Wir
sind in einer völlig unbekannten Umgebung gelandet, haben erstmals wissenschaftliche
Daten auf einer Kometenoberfläche gesammelt und konnten mit diesen die
Messungen des Orbiters ergänzen." Die Mission mit Rosetta und Philae habe
gezeigt, dass die Aktivität eines Kometen deutlich komplexer abläuft als
gedacht. "Wir haben viele neue Hinweise gewonnen, aber von einem
endgültigen Verständnis sind wir noch weit entfernt."
Auch wenn die Arbeit mit Philae Wünsche offen gelassen
hat - beispielsweise die chemische Untersuchung einer Bodenprobe oder mehr Zeit
für wissenschaftliche Messungen: "Solche hochaufgelösten und spektakulären
Bilder wie von der ROLIS-Kamera, die unterhalb des Landers sitzt, sowie von der
Panoramakamera CIVA werden wir lange Zeit nicht mehr bekommen." Außerdem
wurden mit einem Massenspektrometer organische Moleküle auf der Oberfläche
gefunden und mit der Thermalsonde MUPUS sowie dem Seismometer SESAME
physikalische Eigenschaften der Kometenoberfläche bestimmt. Der Kometenkern
wurde von Sonde zu Lander mittels Radarstrahlen durchleuchtet, woraus
Erkenntnisse über seine Struktur gewonnen werden konnten. Ein messbares
Magnetfeld wies der Komet nicht auf. Viele Ergebnisse wurden inzwischen in wissenschaftlichen Journalen publiziert.
"Die Auswertung der Daten wird
jedoch noch über mehrere Jahre weitergehen", betont DLR-Planetenforscher
Dr. Ekkehard Kührt.
Wissen für zukünftige Missionen
Mit der Rosetta-Mission wurden gleich mehrere Premieren
im All gefeiert: Noch nie begleitete eine Raumsonde einen Kometen auf seinem
Weg um die Sonne, noch nie landete ein Gerät auf einer Kometenoberfläche, um
dort Messungen durchzuführen. "Wenn man einen Vergleich mit anderen
historischen Missionen sucht, wären dies vielleicht die Viking-Mission, die zum
ersten Mal detaillierte Bilder vom Mars sendete, oder auch die Voyager-Sonden,
die einen Blick auf die großen Planeten unseres Sonnensystems ermöglichten",
sagt Philae-Projektleiter Dr. Stephan Ulamec vom DLR. Die Landung mit Philae
war zudem auch eine gute Lehrstunde: "Wir können zukünftige Missionen
besser an die Bedingungen auf einem Kometen anpassen."
Die letzten Fotos
von Philae wird es sehr wahrscheinlich im Sommer 2016 geben, wenn die
Rosetta-Sonde in nahen Vorbeiflügen auf den Lander blickt. "Wenn wir dann
sehen, wie Philae positioniert ist, können wir manche Daten wie die Messungen
des Radar-Experiments CONSERT noch besser interpretieren." In etwa sechs
Jahren werden Philae und die Rosetta-Sonde, die im September 2016 zum Abschluss
der Mission auf dem Kometen landen soll, zumindest wieder der Erde nahe sein -
dann hat Komet Churyumov-Gerasimenko die Sonne ein weiteres Mal umrundet.
Die Mission
Rosetta ist eine Mission der ESA mit Beiträgen von ihren
Mitgliedsstaaten und der NASA. Rosettas Lander Philae wird von einem Konsortium
unter der Leitung von DLR, MPS, CNES und ASI beigesteuert.
Kontakte:
Manuela Braun
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Kommunikation, Redaktion Raumfahrt
Tel.: +49 2203 601-3882
Fax: +49 2203 601-3249
Dr. Stephan Ulamec
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Nutzerzentrum für Weltraumexperimente (MUSC), Raumflugbetrieb und
Astronautentraining
Tel.: +49 2203 601-4567
Dr. Ekkehard Kührt
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Institut
für Planetenforschung
Tel.: +49 30 67055-514
Fax: +49 30 67055-340





